![Pouseurs!, © buckofive [http://www.flickr.com/photos/buckofive/2862473427] CC-BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/poseur.jpg) Nach Lektüre von Helene Hegemanns maßlos überhypten »Axolotl Roadkill« bleibt – neben all dem Copy-and-Paste-Buzz der letzten Tage um diesen »Roman« – bei mir nicht nur ein schaler Beigeschmack hängen aufgrund 200 unnötig gelesener Seiten und fünfzehn verschwendeter Euro, die ich lieber dem abgemagerten Junkie am Kölner Hauptbahnhof hätte in die Hand drücken sollen – nein, zu allem Überfluss tritt auch noch ein diffuses Scheissgefühl von innen gegen mein Brustbein: Diese Wut auf mich selbst. Ich hätte es besser wissen müssen. Eigentlich.
Nach Lektüre von Helene Hegemanns maßlos überhypten »Axolotl Roadkill« bleibt – neben all dem Copy-and-Paste-Buzz der letzten Tage um diesen »Roman« – bei mir nicht nur ein schaler Beigeschmack hängen aufgrund 200 unnötig gelesener Seiten und fünfzehn verschwendeter Euro, die ich lieber dem abgemagerten Junkie am Kölner Hauptbahnhof hätte in die Hand drücken sollen – nein, zu allem Überfluss tritt auch noch ein diffuses Scheissgefühl von innen gegen mein Brustbein: Diese Wut auf mich selbst. Ich hätte es besser wissen müssen. Eigentlich.
Was war passsiert? Am 23. Januar sprang mir ohne Vorwarnung Maxim Billers Rave-Rezension von Axolotl ins Gesicht. Dort las ich folgende Sätze:
Gelöscht. Urheberrecht …
Rohstoff, Irre, Faserland – Wow, das alles in seinem Satz. Okay… Biller hatte mich sofort bei den Eiern. Knapp 10 Tage musste ich warten, bis meine Buchhandlung endlich das Buch liefern konnte („Tut mir leid, aber die Leute kaufen das gerade wie gestört“). Ich schnallte mich an und startete die Lektüre. Auf Seite 12 verzog ich zum ersten Mal genervt die Mundwinkel.
Unter der Dusche prasseln mir in Zeitlupe Tropfen entgegen, die durch den Einfluß der Oberflächenspannung bestrebt sind eine Kugelform zu erlangen.
Okay. Das Mädel ist siebzehn. Sei nicht so hart. Ich übe mich in Verständnis: Hey, es geht ums »Worte finden für: Das.« Aber spätestens ab Seite 119 geht mir dieses manirierte Mitte-Sprech (bzw. diese Pseudo-Literatur) nur noch extremst auf den Sack:
Aus dem sternenübersäten Himmel regnet es heißen Teer, der mir vergegenwärtigt, dass ich auf den untersten Level der Desillusion angekommen bin und sich deswegen keine Chance mehr auf eine heilsame Wendung im Exzess vor mir auftun wird.
Tja, Helenchen, bei meiner Rezeption glaube ich auch an keine positive Wendung mehr. Dem Ganzen wird dann noch die Krone aufgesetzt in Form einer heroisierten (und platt imaginierten) Kinder-vom-Bahnhof-Zoo-Experience, von der ich der Autorin kein einziges Wort glaube:
Ich weiß, es wird nie wieder etwas Geileres in meinem Leben geben als Heroin. Alles, was von nun an passiert, werde ich mit diesem morbiden großbürgerlichen Heroinflug vergleichen, der gerade am Start ist. Ich kapiere nicht mal mehr, dass ihr da seid, ihr seid mir alle so scheißegal, in meinem kompletten Leben wird kein einziger Moment mehr an die Perfektion heranreichen, die gerade vorherrscht.
Phantastisch. Spätestens jetzt habe ich den Papp auf. Dennoch lese ich das Buch zuende. So viel Stil muss sein. Und ich bin froh, als ich es endlich in den Schrank legen kann. Ich habe viel gelesen in meinem Leben. Auch viel Schrott. Selten aber so viel prätentiöses Geschwurbel auf einen Haufen.
Tipp an alle, die meinen, dieses Buch gelesen haben zu müssen, um dem gesellschaftlichen Diskurs folgen zu können: Kauft es nicht. Fallt nicht auf das ungemein geschickte Marketing der selbsternannten Kultur-Avantgarde rein. Ihre Inzest-Maschine zielt auf narzisstische Totgeburten – allerdings mit Spiegel-Bestseller-Status.
Als Fazit bleibt für mich zu konstatieren:
- Maxim Biller kann mir von nun an gestohlen bleiben. Er kann ruhig weiterhin beteuern, dass er Helene Hegemann nicht kennt: »Wie geht es ihr? Wer ist sie überhaupt? Keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Aber wenn Sie unbedingt etwas über sie wissen wollen – sie soll 17 und Tochter eines berühmten Berliner Intellektuellen sein, und einen Film hat sie auch schon gemacht.« Ich glaube ihm kein Wort.
- Obendrein werde ich ihm nie verzeihen, dass er Helmut Kraussers »Fette Welt« (erschien vor Faserland) und Wolfgang Welt nicht als Markstein deutscher Literatur beachtenswert fand – das nur am Rande.
- Ich werde zukünftig wieder skeptischer meine Lektüre auswählen – und mehr auf Empfehlungen aus unabhängigen Quellen lauschen.
- Ich wünsche Helene Hegemann für die Zukunft viel Glück – dass sie ihren eigenen Weg, ihre eigene Stimme findet und sich den Klauen der Alt-Herren-Schickeria entziehen kann und ihnen als Dankeschön noch gehörig ins Gemächte tritt.
- Tipp: Große Literatur speisst sich immer aus eigener Erfahrung bzw. ureigenster Imagination (was manchmal aufs Gleiche hinaus läuft). Second-hand – und so tun, als ob – geht immer immens in die Hose.
Als Beispiel: Jörg Fauser.
Er hat in der Heroin-Hölle Istanbuls vegetiert und fasste (einige) seiner Erfahrungen in folgenden schlichten Sätzen zusammen:
Auf dem Nachtisch lag ein Klumpen Opium. Ringsum schrien die Huren. Auf Sex hatte ich selten Lust. Ich legte mich hin und schlug das Notizbuch auf mit dem Kapitel, an dem ich gerade schrieb. Der Rapidograph war frisch gefüllt. Ein neuer Beschiß, ein neues Bild, ein neues Kapitel. Was hatte Faulkner gesagt? »Ich würde meine Großmutter bestehlen, wenn es mir beim Schreiben helfen würde.« Ich wußte zwar nicht genau, wie er das gemeint hatte (man wußte nie genau, wie diese Leute das gemeint hatten), aber eins stand fest: Ich schrieb.
— Jörg Fauser, Rohstoff (1984)
Poesie. Magischer Realismus. Genau das ist mit »Echtheit« gemeint, liebe Helene.
Aber, du bist ja noch jung. Ich bin da guter Hoffnung…

![Antonio Carlos Castejón: Assim fiquei após a queda (como na foto de Klaus Kinski - por Jean Gaumy) [http://www.flickr.com/photos/carloscastejon/3724275223] CC-BY-NC-ND Antonio Carlos Castejón: Assim fiquei após a queda (como na foto de Klaus Kinski - por Jean Gaumy) [http://www.flickr.com/photos/carloscastejon/3724275223] CC-BY-NC-ND](https://6t8.org/wp-content/3724275223_49b7e59e08_o.jpg)
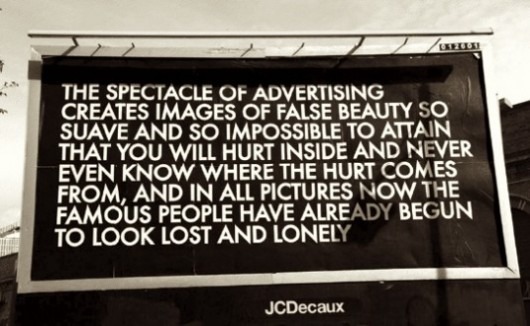
![»Onkel Leif« © aliasgrace [http://www.flickr.com/photos/aliasgrace/73301290] CC-BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/73301290_5e8d034328_o.jpg)
![Pouseurs!, © buckofive [http://www.flickr.com/photos/buckofive/2862473427] CC-BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/poseur.jpg)
![Guardian Angel © Laura Burlton [http://www.flickr.com/photos/lauraburlton/2841127273] CC-BY-NC-ND](https://6t8.org/wp-content/guardian_angel.jpg)
