Es gibt Tage, die sind rund – sie verlaufen harmonisch, beginnen leise, haben einen oder mehrere Höhepunkt und klingen sanft und friedlich aus. Und es gibt Tage, die sind eckig – irgendwann läuft es in eine völlig unerwartete Richtung, mit meist unangenehmen Wendungen, zurück bleibt ein Gefühl der Erleichterung, wenn sie enden. Letztlich gibt es aber auch Tage, die sind derart paradox, dass man Schwierigkeiten hat, die vergangenen 24 Stunden als ein Kontinuum zu begreifen, weil der Gesamtverlauf keinen Sinn macht und sich jeder Einordnung entzieht. Scheinbar.
Gestern war so ein Tag.
Ungemein mild war der Morgen, nach all dem Frost. Der dicke Dompfaff im Pflaumenbaum vor dem Küchenfenster verstand dies sofort als Aufforderung, sich noch mehr aufzuplustern als sonst und pumpte übermütig noch ein Quentchen mehr Farbe in sein Brustgefieder. Bester Dinge machte ich mich auf ins Büro.
Die fünf Minuten Wartezeit am Bahnhof verbringe ich meist in stiller Kontemplation: Mein Blick schweift dabei über die Auen der Sieg, die frühen Vogelschwärme in geschäftiger Aktion – all dies im schönen Licht des dämmernden Tages. Dass ich dabei rauche ist eigentlich nicht erwähnenswert, im diesem speziellen Fall aber essentiell.
Ich stehe also da, ziehe hin und wieder an meiner Zigarette und erfreue mich trotzdem am Duft des Nebels, der vom Wasser des Flusses unterhalb der Gleise zu mir hoch zieht, als ich aus den Augenwinkeln jemanden mit energischem Schritt auf mich zu stapfen sehe. Abrupt bleibt er vor mir stehen, sein Keuchen mühsam unterdrückend, mit einem Gesichtsausdruck, der entschlossen wirken soll.
– Finden Sie das okay?
– Was finde ich okay?
– Dass Sie hier rauchen?
Ich überlege einen Moment. Worauf will er hinaus? Ich wähle die Karte: Ehrliche Antwort.
– Naja, ich rauche gern noch eine Zigarette, bevor ich in den Krieg ziehe, antworte ich freundlich.
Kurzes Schweigen. Ich kann förmlich sehen, wie der Mann mir gegenüber genüsslich all die Worte in seinem Kopf zusammenklaubt, die er sich zwei Minuten vorher mühsam erarbeitet hat.
– Dies ist ein rauchfreier Bahnhof. Machen Sie bitte die Zigarette aus.
Ich betrachte mein Gegenüber genauer: Ein großer Mann steht da, ungefähr Mitte 50. Ein freundlicher grauer Bart umspielt seine etwas verbissenen Lippen. Echt gepflegt, dieser Mann und auf Etiquette bedacht, finde ich. Obendrein läuft er kostenlos Werbung für Jack Wolfskin: Jacke, Rucksack, Schuhe – alles ziert die momentan wohl unvermeidliche Tatze. Schon hat er verloren.
– Schauen Sie sich doch bitte mal um, antworte ich mit einem Lächeln und deute auf den Bahnhof, der im Grunde nichts anderes ist als ein betonierter Ponton mit Gleisanschluss.
– Ich glaube kaum, dass sich hier irgendjemand von meinem Zigarettenrauch belästigt fühlt. Sie wohl am wenigsten, da Sie vor einer Minute noch da hinten unter dem Holzdach standen.
Dabei zeige ich auf den hinteren Bereich des Bahnsteigs, der etwa 20 Meter entfernt ist. Ich selbst stehe am anderen Ende des Pontons, unter freiem Himmel, neben einer Umspannstation, die die hiesige Bevölkerung weiträumig umschifft aufgrund vermeintlicher und böser elektromagnetischer Strahlen. Mich interessiert das nicht, ich bin immun gegen böse Schwingungen – und gewöhnlich auch gegen böse Blicke.
Demonstrativ blase ich eine dicke Wolke aus. Sie zieht an der Umspannstation vorbei. Augenscheinlich belästigt der Qualm niemanden – höchstens ein paar Maden, die in der Kiefer hinter dem Bahnsteig dösen. Ein Husten ist von ihnen jedoch nicht zu hören.
– Sie dürfen hier aber nicht rauchen. Es gibt schließlich Regeln.
Was soll man darauf antworten? Ich überlege und ziehe die Karte: Gesunder Menschenverstand. Auch übe ich mich weiterhin in Freundlichkeit.
– Ja, da mögen Sie Recht haben. Aber nicht alle Regeln machen Sinn. Sie geben meist nur einen Rahmen vor, der kreativ gefüllt werden will. Denken Sie mal an die Steuergesetze.
Kurzes Schnaufen.
– Sie halten sich wohl für etwas Besseres, zischt es zurück. Sie meinen wohl, für Sie gelten keine Regeln, was?
Okay. Dieses Gespräch wird länger dauern, wenn ich nicht aufpasse. Das will ich nicht. Ich kürze also ab, in der Hoffnung, bei diesem Mann – Lehrer oder Ex-Kettenraucher oder beides – auf Einsicht zu stoßen.
– Nein. Wenn mir eine Regel sinnvoll erscheint, dann halte ich sie auch gerne ein. Im Zug, zum Beispiel, da rauche ich nicht, weil ich niemanden mit meinem Qualm belästigen möchte. Verstehen Sie, was ich meine?
Er will nicht verstehen.
– Junger Mann (ich fühle mich natürlich sofort geschmeichelt), Sie machen einen sehr intelligenten Eindruck auf mich (jetzt fühle ich mich allerdings weniger geschmeichelt, weil ich begreife, dass er versucht, mich auf diese Tour rum zu kriegen) – wollen Sie nicht verstehen, dass es hier ums Prinzip geht?
Das war leider das falsche Stichwort. Ich hasse Prinzipienreiter. Dementsprechend ändert sich auch meine Tonlage. Dieser Mensch ist nur noch lästig.
– Okay, abschließende Antwort, weil unsere Unterhaltung zu nichts führt: Ich rauche meine Zigarette hier zu ende und werde auch morgen früh wieder eine rauchen. Zwar ist dies hier korrekt betrachtet ein rauchfreier Bahnhof und Raucher sollen einen Raucherbereich nutzen, der leider nicht kenntlich gemacht ist. Ich stehe weit genug entfernt von jeglicher Person. Niemanden – außer mir und meiner Lunge vielleicht – entsteht dadurch ein Schaden. Und nun treten Sie bitte ein Stück zurück – ein Meter sozialer Mindestabstand sollte schon drin sein, finden Sie nicht?
Vergeblich.
– Warum weichen Sie einem Diskurs aus?, säuselt der Oberlehrer. Es geht darum, dass nicht jeder machen kann, was er will. Oder finden Sie das etwa auch okay, wenn Jugendliche mit einem Baseballschläger auf unschuldige Rentner einprügeln? Diese Asozialen halten sich ja auch nicht an Regeln.
Offenbar will er nicht begreifen. Und ich werde langsam wütend.
– Mein Rauchen hat mit verbitterten Kids nichts zu tun. Und Ihre Prinzipen ändern auch nichts an dieser Tatsache. Im Gegenteil: So eine Haltung wie Ihre — ich nenne sie mal salopp ‚Blockwartmentalität‘ — war dafür verantwortlich, was ’33 passieren konnte. Und nun hören sie endlich auf, mich zu nerven. Ich diskutiere ungern mit Faschisten.
Sein Gesicht wird rot.
– Was haben Sie gesagt? Das lasse ich nicht auf mir sitzen!
Ich schnippe wortlos die Kippe in den Busch neben der summenden Trafostation. Konsterniert und wutschnaubend blickt er mich an.
– Wissen Sie, was Marderspray ist? Das bringe ich morgen mit. Dann werden wir schon sehen.
Der Zug läuft ein und ich achte darauf, dass mir dieser Mensch nicht in den gleichen Waggon folgt.
Mein Arbeitstag verläuft in gewohnter Routine: Kindischer Stress, jede Menge menschlicher Abgründe und nichtsdestotrotz zahlreiche stille Momente voller Poesie und Schönheit. Dann Feierabend und Rückweg. Mein Zug hält wieder am Ponton mit Gleisanschluss, diesmal aus umgekehrter Richtung. Inzwischen ist es dunkel. Ich steige in meinen Wagen, fahre vom Parkplatz und bemerke, dass ein junger Mann mit diversen Trolleys zaghaft seinen Daumen raushält, um mir zu signalisieren, dass er einen Lift braucht. Ich bremse neben ihm und mache von innen die Beifahrertür auf.
– Wo musst du hin?
Der junge Mann scheint nicht glauben zu können, dass ihn jemand mit nehmen möchte. Er zögert einen Moment.
– Komm, steig ein. Um diese Zeit fährt hier kein Bus mehr.
Völlig perplex wirft der Junge seine sieben Sachen in diverse Bereiche meines Kombis und steigt endlich ein. Er hat seine Sprache immer noch nicht gefunden, als ich los fahre.
– Ich muss Richtung Dattenfeld. Soll ich dich irgendwo raus lassen? Ist das überhaupt deine Richtung?
Endlich findet der Junge wieder Worte und eröffnet mir, dass er zum Internat auf dem Berg muss. Alles klar, kenne ich, kein Problem.
Im Laufe der kurzen Fahrt plaudern wir über dies und das. Dass er in die 11. Klasse geht ist nicht schwer heraus zu finden – seine Art zu Erzählen und sein Äußeres sind einfach zu verräterisch. Wir sprechen über Abi-Stress und G8, über meine Tochter, deren Namen er unbedingt wissen will und über meine überaus entspannte Zeit in der Oberstufe, damals, als ich stets erst gegen 12.00 in der Schule auflief, weil ich nur die Mindeststundenzahl belegt hatte. Wir lachen viel, während wir an der Hochwasser-geschwängerten Sieg entlang tuckern.
– Hey, Sie sind echt ein total netter Kerl. Bisher haben mich nur Frauen mitgenommen, nie Männer, sagt er dann unvermittelt.
Was soll ich darauf antworten? Ich ziehe das Schweigen vor. Irgendwann halten wir vorm Internat, ich drehe den Motor ab. Wir sitzen nebeneinander vorne im Auto und blicken auf die blinkende Hausnummer des Schulgebäudes. Schweigen. Dann:
– Wissen Sie was? Sie sind echt der netteste Mensch, der mir je begegnet ist, sagt er nach einem langen Moment.
– Quatsch, du übertreibst, antworte ich und meine es genauso, wie ich es sage.
– Nee, wirklich. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der so nett ist, wie Sie.
Dieser 17-jährige Junge blickt mich strahlend von der Seite an und weiß nicht, ob er jetzt aussteigen und seine Sachen nehmen soll. Ich denke einen Augenblick über seine Worte nach.
– Das ist schade, antworte ich nach einem Moment. Wäre es nicht viel schöner, wenn man viel öfter im Leben netten Menschen begegnen würde?
Der Junge denkt schweigend über meine Worte nach, grinst, steigt aus, zieht seine diversen Trolleys und Koffer aus dem Auto, schließt die Türen und winkt mir im Gehen noch mehrmals freundlich zu.
– Vielen Dank! Und grüßen Sie Ihre Tochter von mir, ruft er noch, als ich den Wagen wende und ich mich mit einer stummen Geste von ihm verabschiede.
Während der restlichen Minuten meiner Heimfahrt denke ich über diesen merkwürdigen Tag nach. Mich überkommt schließlich die leise Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist. Es kann zukünftig nur besser werden. Und ich leiste gerne meinen Beitrag dazu.
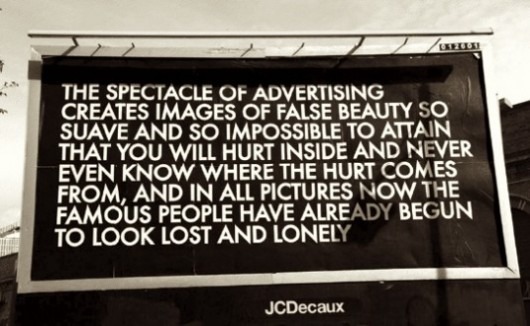
 Während so genannte Künstler irgendwann einmal so ein bisschen den
Während so genannte Künstler irgendwann einmal so ein bisschen den !["Jesus rettet - das Plakatiergewerbe" von mkorsakov [http://www.flickr.com/photos/mkorsakov/523607180] CC-BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/523607180_aade0c6724.jpg)
![biphop: Guy Debord (stencil) [http://www.flickr.com/photos/biphop/2272428246] BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/2272428246_d436e7a442_o.jpg)
![»Onkel Leif« © aliasgrace [http://www.flickr.com/photos/aliasgrace/73301290] CC-BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/73301290_5e8d034328_o.jpg)
![Guardian Angel © Laura Burlton [http://www.flickr.com/photos/lauraburlton/2841127273] CC-BY-NC-ND](https://6t8.org/wp-content/guardian_angel.jpg)