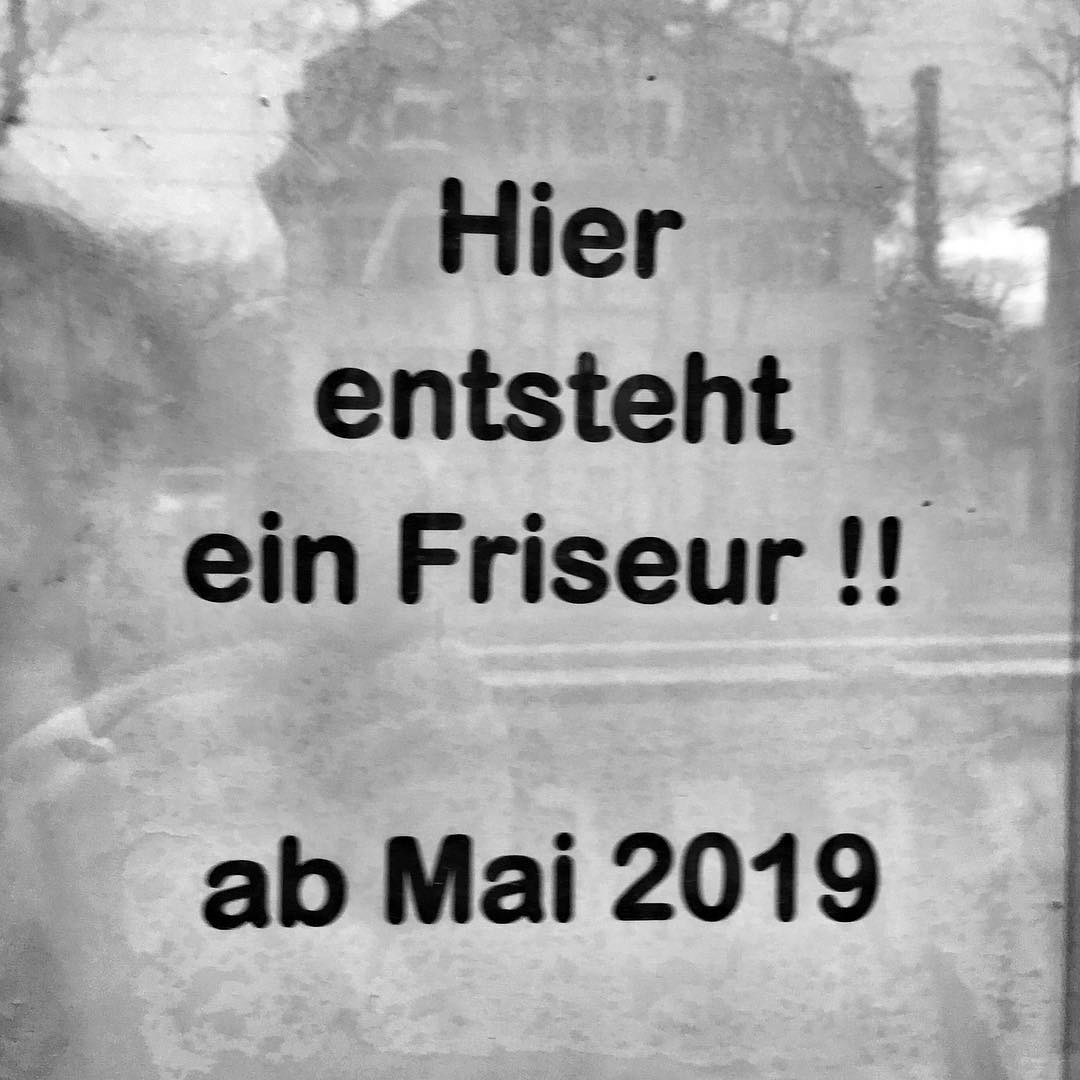Kontrolle, Zelte und der ganze Rest
Er hatte das Herz am rechten Fleck, grundsätzlich. Braungebrannt, dreitagebärtig, mit leuchtenden Augen. Leider war er auch uniformiert und mit einem klaren Auftrag am Start. Dafür hasste ich ihn in diesem Moment.
»Das können Sie nicht mit in die Kabine nehmen«, sagte er und ließ dabei den beigen Stoffsack zwischen seinen Fingern und vor meinem Gesicht hin und her baumeln.
»Wie jetzt? Ich hab’s doch auch auf dem Hinflug in meiner Hosentasche gehabt!«
Das entsprach der Wahrheit. Half aber nichts.
»Tja, dann haben die Kollegen in Deutschland nicht richtig kontrolliert. Tut mir leid.«
Aber er hatte eine Idee. Er fand sie offenbar genial, sein Lächeln reichte von Ohr zu Ohr.
»Sie können es im Koffer verstauen. Das ginge. Sie haben noch nicht eingecheckt?«
Doch, hatte ich. Und hatte somit nun ein Problem. Ein großes. Jedoch: Ich kann, wenn ich möchte, sehr charmant sein. Das hat oft Wunder bewirkt. Angesichts der Sachlage konnte nur noch so etwas helfen.
»Nee, der ist schon weg«, antwortete ich traurig, suchte und fand seinen Blick.
»Monsieur, dieses Ding ist mir wichtig. Sehr wichtig. Ich hänge dran. Es hat eine besondere Bedeutung für mich. Ein Freund hat es mir vor Jahren geschenkt. Ich kann es nicht zurücklassen. Sie sind ein guter Mensch, das sehe ich. Machen Sie eine Ausnahme – und nicht zwei weitere Menschen unglücklich. Bitte.«
Monsieur schloß die Hand um den Stoffsack, dann kurz seine Augen, ein Kopfschütteln – voll mit echtem Bedauern. Immerhin. Mein Flug ging in einer halben Stunde.
Köln ZOB. Sommer. Fünf Jahre vorher. Ich hole ihn ab, er kommt aus Millau, Frankreich, Zentralmassiv, hat ätzende 22 Stunden Busfahrt hinter sich. Er ist Künstler. Und pleite. Mal wieder. In den letzten Jahren habe ich ihn oftmals mit Geld unterstützt. Nun braucht er für ein paar Wochen einen Ort, um sich innerlich zu sortieren. Diesen gebe ich ihm. Gerne. Er ist mein Freund.
»Halt mal die Hand auf«, sagt er grinsend, nachdem wir uns aus der Umarmung gelöst haben. Ich stutze und strecke unsicher meine Rechte hin. Er kramt in seiner Jacke, holt etwas heraus und überreicht es mir. Es ist ein kleiner Leinenbeutel, nicht schwer, bedruckt mit einer Biene. Im Beutel befindet sich ein Messer, stelle ich fest, als ich die Schnüre oben löse. Genauer: ein Laguiole. Handarbeit aus der Auvergne. Teuer. Ich habe keine Ahnung, wo er das Geld dafür her hat. Vielleicht hat er sich die annähernd 200€ vom Mund abgespart. Er sieht noch magerer aus als bei unserem letzten Treffen.
»Das ist zu viel. Das kann ich nicht annehmen!«
Er schweigt. Ich versuche, ihm das Messer zurück in seine Jacke zu stecken. Keine Chance.
»Nimm es. Bitte.«, sagt er und lässt keinen Zweifel daran, dass er es ernst meint. Ich lasse meinen Widerstand fahren. Und umarme ihn erneut. Noch fester.
Ich hatte ihn angerufen. Mitten in der Nacht. Mir war gerade mein Leben implodiert. Er sagte nur: »Komm.«
Am nächsten Tag setzte ich mich in den ersten Flieger Richtung Mittelmeer. Da wohnte er inzwischen. Ich schlief auf dem Sofa, das in der Loggia stand. Morgens weckten mich die Möwen. Er fragte mich nie. Wartete geduldig, dass ich zu erzählen begann. Hörte zu und schwieg. Er wartete, dass ich mir die Antworten, die ich brauchte, irgendwann selber gab. Dann nahm er mich in den Arm und führte mich in ein Bistro oder eine Bar. Wir tranken. Gemeinsam. Viel. Wir Lachten. Und torkelten anschließend leichtfüßig den Strand entlang. Der abnehmende Vollmond schenkte uns Licht, wir fielen nicht, wir flogen heim. Zehn Tage blieb ich bei ihm. Etwas mehr als eine Woche reichte, um zu wissen, was nun zu tun war. Zelte baut man auf. Man baut sie auch wieder ab, wenn es Zeit war, zu gehen. Meins stand nicht in Südfrankreich. Es verrottete woanders.
»Es gibt da noch eine letzte Möglichkeit.«
Der Security-Mitarbeiter vom Flughafen blickte zuerst auf den Stoffbeutel in seiner Hand, dann mir direkt in die Augen. Er wirkte überraschend ernst.
»Drüben ist eine Papeterie«, sagte er nach einem Moment und deutete auf einen Zeitschriften- und Schreibwaren-Shop am Ende der Abflughalle.
»Stecken Sie das Messer in einen Umschlag und schicken Sie es sich nach Hause.«
Ich schwieg weiterhin. Seine Idee war lieb gemeint, ja. Ich wusste gleichzeitig aber auch um die französische Post, welche Risiken sich mit einem Versand verbanden. Mein Freund hatte mir mehrfach berichtet, dass Lieferungen nicht ankamen, geklaut wurden, unauffindbar blieben. Auch der Sicherheitsbeamte schwieg nun. Nach einem Moment drückte er mir das Messer in die Hand.
»Vertrauen. Mehr können Sie jetzt nicht tun.«
Ich nickte stumm. Er hatte Recht. Ich ging zur Papeterie. Es gab wattierte Umschläge, sicher ein minimaler strategischer Vorteil, um einen Diebstahl etwas unwahrscheinlicher zu machen. Hoffte ich. Die Verkäuferin lieh mir ihren roten Filzstift, ich schrieb meine Anschrift drauf. Hielt aber inne, nachdem ich meinen Vornamen vollendet hatte. Als Nachnamen wählte ich – und in Großbuchstaben – jenen »Mädchen«- bzw. Familiennamen, den ich wieder annehmen würde, wenn mein Zelt sorgsam eingepackt war, um woanders aufgeschlagen zu werden. Der Umschlag plumpste sanft in den Briefkasten am Ausgang des Flughafens. Mir klopfte dabei das Herz bis zum Hals. Das Messer hatte nun eine zusätzliche Bedeutung für mich. Sollte es ankommen, adressiert an meine neue alte Identität, wäre alles gut. Und ich auf dem richtigen Weg. Ein Omen, sozusagen, dessen Ausgang ich La Poste und Deutsche Post anvertraute. Manchmal muss man loslassen, um festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Ich nickte dem Sicherheitsbeamten zu als ich zum Gate ging. Dann hing ich in der Luft über Zentraleuropa.
Fünf Tage später hielt ich den unversehrten Umschlag erneut in den Händen. Ich küsste ihn. Packte das Messer zu meinem Zelt, das bereits sorgsam verschnürt war, stieg in meinen französischen Kleinwagen und fuhr der aufgehenden Sonne entgegen.
[Beitrag für: Standort West 06/2019]
Max Cooper – Hope (Parra For Cuva Remix)