Sätze.
Vorsätze.
Verstummt, verdammt lange.
Zweifelnd, den Worten.
Ein Irrlauf, ein weiterer nur:
Nicht ihnen mehr hinterher
werde ich nun eilen,
sondern mir entgegen, sie.
In Arme, die offen,
in ein Herz, das es versucht.
Sätze.
Vorsätze.
Verstummt, verdammt lange.
Zweifelnd, den Worten.
Ein Irrlauf, ein weiterer nur:
Nicht ihnen mehr hinterher
werde ich nun eilen,
sondern mir entgegen, sie.
In Arme, die offen,
in ein Herz, das es versucht.
 Keine Zeile. Einen leblosen Herbst, einen schneereichen Winter und fast einen ganzen Frühling lang.
Keine Zeile. Einen leblosen Herbst, einen schneereichen Winter und fast einen ganzen Frühling lang.
Zweihundertundsechsunddreißig Tage – Schweigen.
»Es war zu kalt« wäre wirklich eine zu lausige Ausrede, die hat niemand verdient. Dennoch kommt es dem, was ich am Fuße des Brunnens empfand, am nächsten.
Es wird wärmer. Die Welt erfindet Geschichten. Du dürstet nach ihnen.
Und ich? Ich hätte fast vergessen, dass ich ohne sie nicht leben kann.
Glückauf!
Jeder andere wäre gnadenlos in den Kitsch entglitten – bei diesem Thema: Hühnermassenhaltung: Herzschmerz und »Ein bißchen Frieden.« Doch Peter Broderick, dieser geniale und noch sehr junge Poet, schafft das nahezu Unmögliche und eröffnet uns durch seine gefühlvolle Introspektion in das Hirn eines Schnitzels in spe völlig neue Zugangswege zum Leid dieser gefiederten Insustrieprodukte. Schon allein der Titel des Songs – »Human Eyeballs on Toast« – verdient Respekt: Selten wurde berechtigte Wut so kunstvoll-assoziativ in Worte gemeißelt. Und dient obendrein als Allegorie der gegenwärtigen conditio humana.
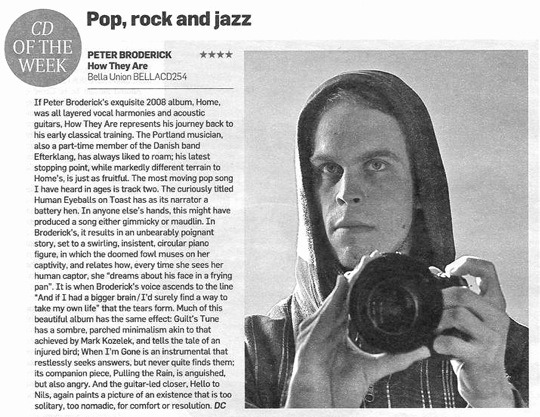
Das Stück ist übrigens Titel No. 2 seines kürzlich auf Bella Union erschienen Albums »How They Are«, das quasi in einem Rutsch und ungefiltert auf einem 4-Spur-Rekorder aufgenommen wurde.
Dass dieses Album empfehlenswert ist muss ich hier nicht extra erwähnen.
Erwähnen möchte ich allerdings, dass Peter in Kürze einer seiner seltenen Auftritte in Deutschland hat:
Am 12. Oktober im Steinbruch, Duisburg.
Und ich werde natürlich da sein.
Peter Broderick – Human Eyeballs On Toast (Studio Recording)
Worte haben Macht. Und das meist sogar ohne jegliche Gewalt. Oft reicht schon der Klang. Für Assoziationen. Und das Prägen unserer Gedanken und Gefühle.
Will Hoffmann (dessen wunderbares Video »Moments« hier schon vorgestellt wurde) hat zusammen mit Daniel Mercadante für Radiolab einige eben jener Worte in vielschichtige Bilder verwandelt. Mal humorvoll, mal tiefsinnig. Immer jedoch anregend.
Früher, als ich noch als Script-Editor tätig war, hatte ich eine wiederkehrende Phantasie: Szenen von nicht ganz so sprachbegabten Autoren ganz wörtlich zu verfilmen, also: „Er schoss um die Ecke“, „Sie beschleunigte ihren Schritt“, „Sie treten aufs Gas“. Ist leider nichts draus geworden – nein, eher: Gottseidank! Denn Wills Version ist einfach viel poetischer.
Das gleiche gilt auch für die Musik: Der Score ist nämlich von Keith Kenniff (er sollte hier auch schon hinlänglich bekannt sein). Keith hat übrigens heute unter seinem Goldmund-Label ein neues Album namens »Famous Places« auf Western Vinyl veröffentlicht. Er beschreibt darin musikalisch einige wichtige Orte seines Lebens.
Das Stück »Fort McClary« daraus gibt es hier als freien Download.
Genug der Worte: Film ab.
Radiolab and NPR – Words
Sie sitzen in einem Restaurant, und zum Essen ertönt aus dem Lautsprecher laute, rhythmische Musik.
Sabina sagt: »Das ist ein Teufelskreis. Die Leute werden schwerhörig, weil sie immer lautere Musik hören. Und weil sie schwerhörig sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig als noch lauter aufzudrehen.«
»Du magst keine Musik?« fragt Franz.
»Nein«, sagt Sabina. Und dann fügt sie hinzu: »Vielleicht, wenn ich in einer anderen Zeit gelebt hätte…«, und sie denkt an die Epoche von Johann Sebastian Bach, als die Musik einer Rose glich, die blühte im unendlichen Schneefeld der Stille.
— Milan Kundera: Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins (1984)
Ich brauchte fast ein Vierteljahrhundert, um gänzlich zu begreifen, was Sabina damit meint.
 Zurück aus dem Moloch, in dem alles steht, besonders die Luft – an einem Tag, der als der heißeste des Jahres 2010 in die Wetteraufzeichnungen eingehen wird. Aber, gottseidank: Landluft macht frei. Zumindest den Kopf. Zumindest meinen. Es gibt eine Stelle, die ich dann gerne aufsuche – hier draußen, im Sommer: Unsere wilde Obstwiese, mit den alten Apfelbäumen, der trotzigen Pflaume und natürlich mit der majestätischen Kirsche, die über all dieser Pracht wacht.
Zurück aus dem Moloch, in dem alles steht, besonders die Luft – an einem Tag, der als der heißeste des Jahres 2010 in die Wetteraufzeichnungen eingehen wird. Aber, gottseidank: Landluft macht frei. Zumindest den Kopf. Zumindest meinen. Es gibt eine Stelle, die ich dann gerne aufsuche – hier draußen, im Sommer: Unsere wilde Obstwiese, mit den alten Apfelbäumen, der trotzigen Pflaume und natürlich mit der majestätischen Kirsche, die über all dieser Pracht wacht.
Bei Dämmerung weht auf dieser Wiese eine angenehme Kühle von den umliegenden Feldern heran – dieses Jahr sind sie bestückt mit gelbleuchtendem Weizen und garantiert genunmanipulierter Gerste. So sitze ich dort, im Hängestuhl meiner Erstgeborenen. Er baumelt an jenem Arm des alten Kirschbaums, der exakt auf Minute und Sekunde eingenordet ist. Das Hachenburger Pils in meiner Rechten ist eiskalt, die Zigarette in meiner Linken frisch entflammt, der Himmel erstrahlt in nahezu kitschigem Mauve und hin und wieder segelt lautlos eine Fledermaus durch die umliegenden Wipfel. Mein Kopf jedoch: Er ist noch nicht ins Hier und Jetzt gelangt. Diffuse Gedanken, dumpfe Gefühle und eine schwer in Worte zu fassende Unzufriedenheit spielen darin Karambolage. Glühwürmchen schwirren herbei, drehen ihre grünen Arschlampen posermäßig auf Volllast, bemerken dann enttäuscht, dass ich weder ein zu becircendes Weibchen ihrer Art bin noch auf irgendeine andere Weise paarungsbereit und knipsen ohne große Worte ihr Lichtlein wieder aus. Schlagartig fühle ich mich traurig.
Ein Kirschblatt fällt herunter und verklemmt sich am Ende seines Sinkflugs hinter dem linken Glas meiner Brille. Genervt zupfe ich es weg und schnippe es in die Wiese, die dieses Jahr aufgrund der andauernden Trockenheit von der sonst üblichen Schneckenplage verschont blieb. Mein grundsätzlich netter Nachbarn ist deshalb sogar noch netter als sonst – was ihn mir ohne Grund suspekt erscheinen lässt. Merkwürdig.
– Na, Chef, wie war dein Tag?
Klar, der alte Herr Prunus war das mit dem Blatt hinter meiner Brille, warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Ich habe lange nicht mehr mit ihm geredet. Weiss der Geier, warum. Vielleicht war es einfach nur zu lange kalt in letzter Zeit. Ja, so wird’s sein. Hoffe ich. Und schweige. Ich hab‘ keine Ahnung, was ich sonst auf seine Frage antworten soll.
– Oha. So richtig scheiße, was?
Einen kurzen Moment denke ich über seine Vermutung nach. Nein, so richtig scheiße war der Tag eigentlich nicht. Eigentlich nur so, wie zu viele in den vergangenen Wochen: mannigfach frustrierend. Ich weiss, Herr Prunus wird so lange bohren, bis er eine Antwort von mir bekommt. Also spreche ich einfach das aus, was mir als Erstes durch den Kopf geht. Mein ehemaliger Analytiker würde jetzt triumphierend und stumm „Strike!“ in sich hinein rufen.
– Ich fühle mich alt. Müde. Mein Glaube an das Schöne wird schwächer. Ich leide. Besonders an der Dummheit von so vielen Menschen. Und gleichzeitig an der Erkenntnis, dass diese armen Kreaturen es im Grunde nur nicht besser wissen, weil sie den wahren Grund für ihre Pein nicht kennen – und deshalb eigentlich aufrichtig zu bemitleiden sind.
Ich nehme einen Schluck Bier und hoffe, Herrn Prunus durch den immensen Tiefgang meiner Gedanken wenigstens für eine Weile spachlos gemacht zu haben. Irrtum. Er lacht! Blätter und verwelkte Blüten regnen auf mich herab.
– Ah, die Jesusnummer, verstehe. Du trägst mal wieder die Last der ganzen Welt auf deinen Schultern. Das ist echt hart. Und absolut unangebracht. Aber das sagte ich dir bereits. Irgendwann. War es Herbst? Egal. Du hast es vergessen. Du Kretin.
Ich blicke stumm auf den finstren Waldrand. Es ist fast Nacht. Ich könnte jetzt wortlos ins Haus gehen und laut Musik hören. Irgendetwas hält mich davon ab. Stolz. Und der unbändige Wille zur Rechtfertigung. Siegessicher ziehe ich mit mindestens drei Bar Unterdruck an der gefühlt vierten Gauloise, halte den Rauch sehr lange in der Lunge – was die Bronchien mit dem Zwerchfell sympathisieren lässt und in einem Schluckauf mündet. Peinlich. Sowas! Gerade jetzt.
– Was ich sagen wollte: All das, was ist, raubt mir zunehmend die Lebensfreude. Als Beispiel: In den letzten Jahren habe ich den längsten Tag des Jahres immer irgendwie zelebriert. Habe bis zum Morgengrauen am Flußufer gesessen. Und um die Kostbarkeit des Augenblicks gewusst. Aber dieses Jahr: Nichts, Nada, Null. Um elf ins Bett. Müde. Genervt. Frustriert. Mit dem bleiernem Gefühl von Sinnlosigkeit in den Knochen. Schön ist das nicht. — Wenn du jetzt antwortest, dann bitte etwas produktiver und nicht so von oben herab. Okay?
Eins der Glühwürmchen lässt noch einmal kurz und hoffnungsvoll sein Licht erscheinen. Quasi als letzter Versuch. Und Herr Prunus lässt auf sich warten. Nach Sekunden beredtem Schweigens:
– Sonnenwenden sind grundsätzlich überbewertet. Ein netter Anlass, stimmt. Gehen aber an der eigentlichen Sache vorbei. Was zählt ist auf dem Platz.
– Machst du jetzt auf Bela Rethy für Arme, oder was?
– Du lenkst ab. Und du weisst es. Eigentlich weisst du sowieso schon alles. Das Blöde daran ist nur: Du hast es vergessen. Wissentlich. Du willst leiden. Warum?
Kurz spiele ich mit dem Gedanken, diese scheinbar zu nichts führende Diskussion abzubrechen – doch plötzlich sind unbekannte Geräusche zu hören. Es ist kein Fuchs, der sich scheinbar im Dickicht des nahen Pappelheins erbricht. Auch ist es kein Kauz, der hämisch lacht. Das Geräusch ist alles andere als tierisch, es ist allzu menschlich. In diesem speziellen Fall sogar eindeutig weiblich. Zu hören ist das „Ah! Ja! Oh!“ einer jungen Frau. Ich glaube einen Moment lang einer akustischen Halluzination aufzusitzen – nein, es ist eindeutig: Irgendwo hier am Rande des Tals treiben es gerade zwei Menschen miteinander, ihr Liebesspiel echot leise durch die Nacht. Unglaublich! Ich verharre stumm in meinem Hängestuhl, mit angehaltenem Atem. Herr Prunus ebenfalls. Auf seine Art. Nach einem Moment dann Gewissheit: Dort oben, auf der Bank oberhalb des Bahntunnels lieben sich wirklich zwei Menschen, das verräterische Geräusch von Unterleibern, die in Extase saftig aufeinander klatschen, ist zu hören. Mir fehlen die Worte. Die beglückte Dame, ihren Höhepunkt erreichend, hilft mir schließlich aus, indem sie ein langezogenes und lautstark gehauchtes „Oh! Mein! Gott!“ in den Himmel über Hoppengarten schickt. Stille. Dann:
– Das, zum Beispiel, finde ich verdammt schön.
Herr Prunus hat als erster seine Worte wieder gefunden. Er spricht sie gradewegs aus. Ohne irgendwelchen skurrilen Subtext oder subtiler Ironie. Einfach authentisch. Und äußerst liebevoll. Er meint es so, wie er es sagt.
– Ja, ist das einzige, was ich darauf antworten kann, und ich verabschiede mich stumm von diesem alten, weisen Mann. Das Bier ist leer. Ebenso mein Kopf. Endlich. Nur einen sanften Kuß drücke ich auf die rissige Rinde seines mächtigen Fußes und gehe dann ins Haus zurück.
– Mach die Augen auf, ruft er mir noch zärtlich hinterher.
Bevor ich mich ins Bett lege, stehe ich noch einen Moment oben auf der Terasse vorm Schlafzimmer und blicke hoch zu dieser Bank oberhalb des Bahntunnels. Dort sehe ich plötzlich eine Taschenlampe, die kurz aufleuchtet. Das Licht tanzt hin und her, wie ein Glühwürmchen. Als würde es etwas suchen. Für den Bruchteil einer Sekunde strahlt es auch in meine Richtung. Dann erlischt es. Und ich kann endlich schlafen und nehme mir fest vor, Herrn Prunus morgen ein Glas dieses leckeren Picpoul de Pinet, Jahrgang 2009, zu krendenzen. Aus Dankbarkeit. Und, weil es schön ist, dass es ihn gibt.
Ich will damit nur sagen, die Interpretation von Dingen, die Sprache, ich will damit nur sagen, ich habe es immer wiederholt, weil es mir immer klarer wird und immer mehr Teil von meinem Leben wird, die Frage, d.h. die Erkenntnis, dass die Sprache, das Gefährlichste ist, was es überhaupt gibt, ist ganz egal, welche Sprache sie sprechen, das Missverständnis ist permanent, ununterbrochen, das sehen Sie ja an unserer ganz simplen Unterhaltung … mit Nasenbohren und hintenrum und so – es ist alles so sinnlos!
— Klaus Kinski in einer Talkshow
!["Duralex" von Ben McLeod [http://www.flickr.com/photos/benmcleod/14803601] CC-BY-NC-SA](https://6t8.org/wp-content/14803601_8ed2d92c5a.jpg) Plötzlich weinte er. Still und fast nicht wahrnehmbar, eher ein leises Wimmern. Ihr war das unangenehm. Sie wollte im Grunde doch nur, dass er sie endlich in Ruhe lässt und aufhört, ihr mit seinem komischen Grinsen auf die Nerven zu gehen. Sie griff in ihre Tasche und suchte nach einem Kleenex. Ein klammes Gefühl kroch ihr den Rücken rauf. Jenes Gefühl, das sie eigentlich nie wieder spüren wollte.
Plötzlich weinte er. Still und fast nicht wahrnehmbar, eher ein leises Wimmern. Ihr war das unangenehm. Sie wollte im Grunde doch nur, dass er sie endlich in Ruhe lässt und aufhört, ihr mit seinem komischen Grinsen auf die Nerven zu gehen. Sie griff in ihre Tasche und suchte nach einem Kleenex. Ein klammes Gefühl kroch ihr den Rücken rauf. Jenes Gefühl, das sie eigentlich nie wieder spüren wollte.
Am Nachmittag hatte sie beschlossen, dass ihr Leben sich ändern muss. Hier drehte sie sich zu lange schon im Kreis. Sie würde diese Stadt, die ihr bei jeder Gelegenheit Steine hinterher schmiss, endlich verlassen. Sie wusste, sie muss weg von hier, sie wollte nach Osten, dorthin, wo die Sonne aufgeht. Dieser Entschluss machte sie glücklich, eine angenehme Ruhe breitete sich in ihr aus.
Ein Grund zum Feiern. Sie wollte darauf einen Trinken gehen, nur kurz, ins Elektra, ihrer Lieblingskneipe zwei Strassen weiter. Auch, um sich innerlich zu verabschieden, ganz sanft. Als Anfang.
Sie hatte den zweiten Pernod bei Waltraud bestellt, als ihr dieser Junge am anderen Ende der Theke auffiel. Er musste schon länger da gestanden haben, sein Deckel zierte ein ansehnlicher Kranz. Ihr war er beim Reinkommen gar nicht aufgefallen und auch sonst hatte sie ihn hier noch nie gesehen. Er war sturzbetrunken. Sie spürte, dass er sie eine ganze Weile schon anstarrte. Vorsichtig erwiderte sie seinen Blick. Leichter Ekel kam in ihr hoch, Kerle wie ihn konnte sie nicht leiden. Noch nie. Doch er verstand ihren Blick als Aufforderung. Ehe sie begriff, wie es passieren konnte, stand er bei ihr und lächelte sie an, von unten, aus seinem Milchbartgesicht.
– Hast du mal ’ne Zigarette?
Er riss sich sichtlich zusammen, der Alkoholpegel in seinen Adern war dermaßen hoch, dass er Mühe hatte, seine flatternden Augen zu kontrollieren. Wortlos hielt sie ihm ihre Schachtel hin, mit zittrigen Fingern fischte er eine Kippe heraus und brauchte drei Anläufe, sie zwischen seine Lippen zu stecken.
Warum gerade jetzt, warum gerade ich, dachte sie und bemerkte seinen fragenden Blick von der Seite.
Er wartete auf Feuer. Leicht genervt riss sie ein Streichholz an und hielt es ihm hin.
Waltraud kam, servierte den Pernod und warf ihr einen schnellen, mitfühlenden Blick zu.
– Ich hau ab aus dieser Stadt. Es wird Zeit.
Waltraud nickte beiläufig und verschwand in einem Nebenraum. Sie wußte nicht, was Waltraud von ihrer Entscheidung hielt. Aber es war ihr inzwischen auch egal.
– Nimmst du mich mit?
Der Typ neben ihr kratzte sich nervös am Flaum unter der Lippe.
Keine zwanzig. Und schon fertig und kaputt, ging ihr durch den Kopf. Sie empfand kein Mitleid.
– Nein, sagte sie, dich nehm‘ ich bestimmt nicht mit. Außerdem hast du ja keine Ahnung, wo ich hin will.
Ohne zu fragen griff er nach ihrem Pernod. Sie riss ihm das Glas im letzen Moment wieder aus den Fingern.
– Das ist meiner, okay?
Er zuckte mit der Schulter, versuchte entwaffnend zu lächeln und sah dabei aus, wie ein Vierklässler, den man gerade beim Rauchen erwischt. Sie hatte sich so gut gefühlt heute, so befreit. Und das wollte sie sich auf keinen Fall versauen lassen. Leute, wie er – Schnorrer, Neurotiker – hatten ihr zu lange schon den Blick fürs Wesentliche verbaut. In dieser Stadt wimmelte es von ihnen und ihr Entschluss, hier abzuhauen, war goldrichtig, das wußte sie jetzt.
– Kann ich bei dir schlafen?, fragte er ohne mit der Wimper zu Zucken und sie verschluckte sich fast.
Eine gesalzene Replik lag ihr schon auf der Zunge, doch sie schwieg und durchbohrte ihn nur mit den Augen. Auf dem Weg in die Kneipe hatte sie sich vorgenommen, ihre Energien ab sofort besser einzuteilen. Nicht auf seine unverschämte Frage einzugehen erschien ihr als beste praktische Umsetzung des neuen Vorsatzes. Einen kurzen Moment war sie richtig stolz auf sich.
– Hast bestimmt ’ne große Wohnung, murmelte er ohne Erklärung.
– Korrekt. Ich fahr mit Rollschuhen von der Küche ins Klo. Aber fürs Bad nehm‘ ich das Rad. Ist schneller, antwortete sie etwas zu schroff und ärgerte sich sofort, wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen zu sein.
Der Typ neben ihr pfiff voller Anerkennung durch die Zähne, versuchte es zumindest, es hörte sich an, als ließe jemand die Luft aus einem Ballon. Dann spürte sie seine Hand auf ihrem Unterarm, sie war nass vor kaltem Schweiß. Sein Blick suchte ihre Augen, das wußte sie, aber sie schaute nicht zurück.
– Du bist ’ne tolle Frau, sagte er leise.
Weder übertrieben charmant noch betont beiläufig. Einfach so. Sie nahm einen grossen Schluck Pernod und ging im Kopf all die Sachen durch, die schon bald zu erledigen waren. Sie riss aus ihren Gedanken als sie seinen Kopf an ihrer Schulter spürte. Sein Haar roch streng. Wie eine alte Frau, die der Zivi vergessen hat. Mit einem Ruck entzog sie sich, er konnte sich gerade noch am Tresen festhalten. Aber er lächelte weiterhin tapfer, wie schon die ganze Zeit. Solch ein Gesichtsausdruck war ihr völlig fremd. Es machte sie unruhig.
– Ich bin nicht von hier, musst du wissen, sagte er, als handle es sich dabei um eine Offenbarung.
Erst jetzt bemerkte sie seinen leichten Akzent. Schwäbisch, eindeutig. Sie atmete tief durch und überlegte, wie sie aus dieser Situation wieder rauskommen könnte. Sie wollte doch nur ihre Ruhe, stumm ein, zwei Gläser kippen. Wenigstens einmal. Wenigstens jetzt. Gerade jetzt. Sie schob ihm den Rest vom Pernod rüber und versuchte sich auf die Musik zu konzentrieren, die im Hintergrund lief. Das Stück kannte sie, es hatte eine ganz einfache Melodie, wie bei einem Kinderlied, kleine Terz, große Terz. Ihr fiel der Titel nicht ein und das machte sie unruhig. Er nahm einen Schluck von ihrem Glas. Ganz so, als wäre es schon immer seins gewesen. Er war tatsächlich sturzbetrunken, kein Zweifel. Sie fragte sich, ob Waltraud den Ehrenkodex vergessen hat: Gäste, die eindeutig genug haben, bekommen nichts mehr. So kannte sie es von früher. Als sie selbst noch auf der anderen Seite des Tresens stand. Wieder bemerkte sie seinen Blick, wie er auf ihr haftete. Unangenehm. Sein blödes Grinsen machte sie langsam wahnsinnig. Dann rutschte er ab und knallte mit seinem Kopf unten gegen ihren Hocker.
– Grossartig, murmelte sie leise und zog ihn schnell wieder hoch.
Er lächelte weiter als wäre nichts geschehen. Nach unendlichen Sekunden hatte er es geschafft, wieder auf seinem Hocker Platz zu nehmen. Wie er jetzt so da saß, leicht schwankend, dieser Milchbart, seine öligen Haare ins Gesicht gefallen – das erinnerte sie an jemanden. Ihr fiel schließlich ein, an wen: an ihren jüngeren Bruder. Drei Jahre hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Mindestens. Dieser Gedanke ließ sie ungewohnt erschrecken. Er kippte die letzen Tropfen Pernod in sich rein, dabei entglitt ihm das Glas aus den Fingern, fiel zu Boden und zersplitterte in Tausend Teile.
– Scheiß Duralexgläser.
Sie beugte sich über die Theke zu Waltraud.
– Schlimmer als Autoglas. Aber du wolltest ja nicht hören.
Waltraud seufzte, kramte einen Handfeger hervor und kam vor die Theke. Er aber hatte offenbar sein kleines Malheur gar nicht mitbekommen. Mit leeren Blick starrte er auf die Digitalanzeige des CD-Players hinten im Regal.
Wie alt der wohl ist? Achtzehn? Höchstens, dachte sie und rückte mit dem Hocker ein Stück zur Seite, damit Waltraud die Scherben zusammen kehren konnte.
– Hey, ist wohl besser, du gehst jetzt nach Hause, sagte sie betont freundlich in seine Richtung, sonst macht sich deine Mama noch Sorgen.
Die CD war zu ende, mit leisem Surren fuhr der Laser in seine Ausgangsposition zurück. Mist, wie hieß dieses Stück noch mal? Ihr wollte es partout nicht einfallen. Ich werd sie wohl fragen müssen, dachte sie und beobachte Waltraud – sie war mit den Scherben fast fertig.
– Sie kann sich keine Sorgen mehr machen, weißt du?, sagte er genau in jenem Moment, als ihr entfallen war, dass sie ihm diesen wohl gemeinten Tip gegeben hat.
Sie blickte irritiert in seine Richtung, sah, dass er immer noch stur auf die rote Anzeige des CD-Players starrte, als hoffe er, die Ziffern würden erneut zu tanzen beginnen und es dauerte ewig, bis sie bemerkte, dass ein leichtes Zucken durch seinen Körper ging. Sie erkannte nicht gleich, was mit ihm los war und hielt es anfangs für einer Art motorischen Tick. Dann wurde ihr klar, dass er weinte. Kaum merklich, aber er weinte.
Scheiße, dachte sie, warum immer ich?
Schweigend zog sie ein Kleenex aus der Tasche und ihr war klar, dass es nicht bei diesem einen bleiben würde.
Sehr schöne Idee – sehr nachahmenswert: Man nehme ein x-beliebiges, verblödendes Wahlplakat/Werbeplakat und korrigiere es ein bisschen — mit Poesie.
So geschehen kürzlich in London: Das „Shoreditch Department of Advertising Correction“ zeichnet sich verantwortlich für diese kreative Aktion in London vom 19. April 2010.
Es waren übrigens Wahlplakate der Konservativen.
Mehr davon hier.
(via rebel:art)
Question: People see Rock ’n‘ Roll as youth culture and when youth culture becomes monopolized by big business what are the youth to do? Do you have any idea?
Answer: I think we should destroy the bogus capitalist process that’s destroying youth culture.
So, als Anfang wäre das schon mal gar nicht schlecht, stimmt.
The Radio Dept. – Heaven’s On Fire
Sehr feiner Indie-Pop aus Schweden. Perfekter Score für den Frühling.
(Meint auch Thaddi in der aktuellen de.bug – danke für den Tipp!)
– The Radio Dept. – Heaven’s On Fire (aus: Clinging To A Scheme, Labrador Records 2010)